Claire-Louise Bennett (2015): Teich. München: Luchterhand.
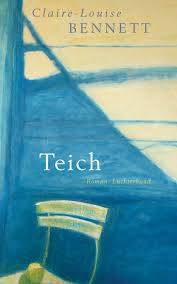
(c) Luchterhand Verlag
Ich mag Bücher, die mir das Gefühl geben, dass es sein kann, ein Leben, welches nicht komplett in Leistungslogiken aufgeht, sondern nach anderen Prämissen mäandernd, nachdenklich, offen und weit ab von gesellschaftlichen Normalitätslogiken ist. Ich mag Bücher, die mir das Gefühl geben, dass es für andere auch schwierig sein kann rauszugehen, Ordnung zu halten, innen und außen, Ängste positiv bei sich zu lassen, einen eigenen Rhythmus zu finden, mit so gesellschaftlich selbstverständlich und klaren Job- und Beziehungslogiken zu hadern, sich selbst zu verstehen und andere stehen zu lassen.
Ein solches Buch ist Teich. Ein Buch über das Staunen an sich selbst in einem Leben, in dem, nach Krimi- und Leistungskriterien, vielleicht nicht so unglaublich viel passiert – und in dem gerade deshalb sehr viel inneres Bewegen, Nachdenken, Humor, Zweifeln, Freuen und Fragen, geteilt wird. An vielen Stellen habe ich laut gelacht beim Lesen, vieles habe ich zweimal gelesen, um es auf mich wirken zu lassen in aller Langsamkeit und Deutlichkeit. Teich ist ein Buch des sich selbst Begegnens für mich, Nachspürens und sich Akzeptierens. Die Ich-Erzählerin ist aufs Land gezogen, in ein Haus mit Garten. Aber ohne die momentan so häufigen Wünsche eigenes Gemüse anzubauen und sich im Garten zu selbstverwirklichen. Der Garten ist da, das Haus ebenso. Die Autorin begegnet beidem, ohne in ihnen aufzugehen. Die Erzählung, unterteilt in viele kleine Essays, die auch gut für sich stehen können, gibt dem Staunen und Wundern Raum in einem Leben, in dem das Selbstverständliche erzählenswert wird. Duschen. Rausgehen oder auch nicht. Vögel und Menschen beobachten. Einkaufen. Sich mit Menschen treffen. Sowas wie Nahbeziehungen kurz immer mal wieder leben. Telefonieren mit Verwandten. Ein wunderbares Buch zum Ankommen, sich selbst sein lassen, nachspüren, lachen und berührt werden.
Wie nebenbei wird die Fremdheit in Beziehungen zu anderen Menschen – im Falle der Ich-Erzählerin zu Männern, erzählt und die damit einhergehenden Strategien sowie das vielleicht späte Erkennen, dass diese Form der heterosexuellen Nahbeziehungen recht wenig zu der Erzählerin passen bzw. sie sich in diesen Begegnungen fremd bleibt und diese Fremdheit zum Beispiel mit Alkohol überbrückt in sich selbst. Um weniger zu spüren. Ehrlich und klar und gleichzeitig so wunderbar staunend erzählt – eine grandiose Darstellung von den Zwängen von Heteronormativität und den Folgen, die dies haben kann, wenn Menschen sich nicht Raum und Zeit und Mut nehmen, dem nachzuspüren. Es ist kein lesbisches Coming Out, sondern ein Sich-Eingestehen der strukturellen und verinnerlichten Diskriminierung, die Heteronormativität ist.
Auch wie nebenbei, gibt es eine ganze Reihe von Sprachreflexionen – über das Stimmen und Nicht-Stimmen von Begriffen, über das Sich-Wiederfinden im Sprechen und der Fremdheit, die die Sprache an sich für die Ich-Erzählerin ist. So schlussfolgert sie, dass sie vielleicht ihre Erstsprache noch gar nicht kennt und vielleicht auch nicht kennenlernen wird.
Das ganze Buch ist getragen von einer Fremdheit an sich selbst und dem liebevollen Suchen eines Begegnens mit sich selbst in dieser allumfassenden, allumgebenden Fremdheit, die das Leben mithin sein kann.
Auf jeden Fall sehr empfehlenswert als berührende, sich selbst begegnende Lektüre für Menschen, die ein allgemeines Funktionieren für sich selbst reflektieren wollen.